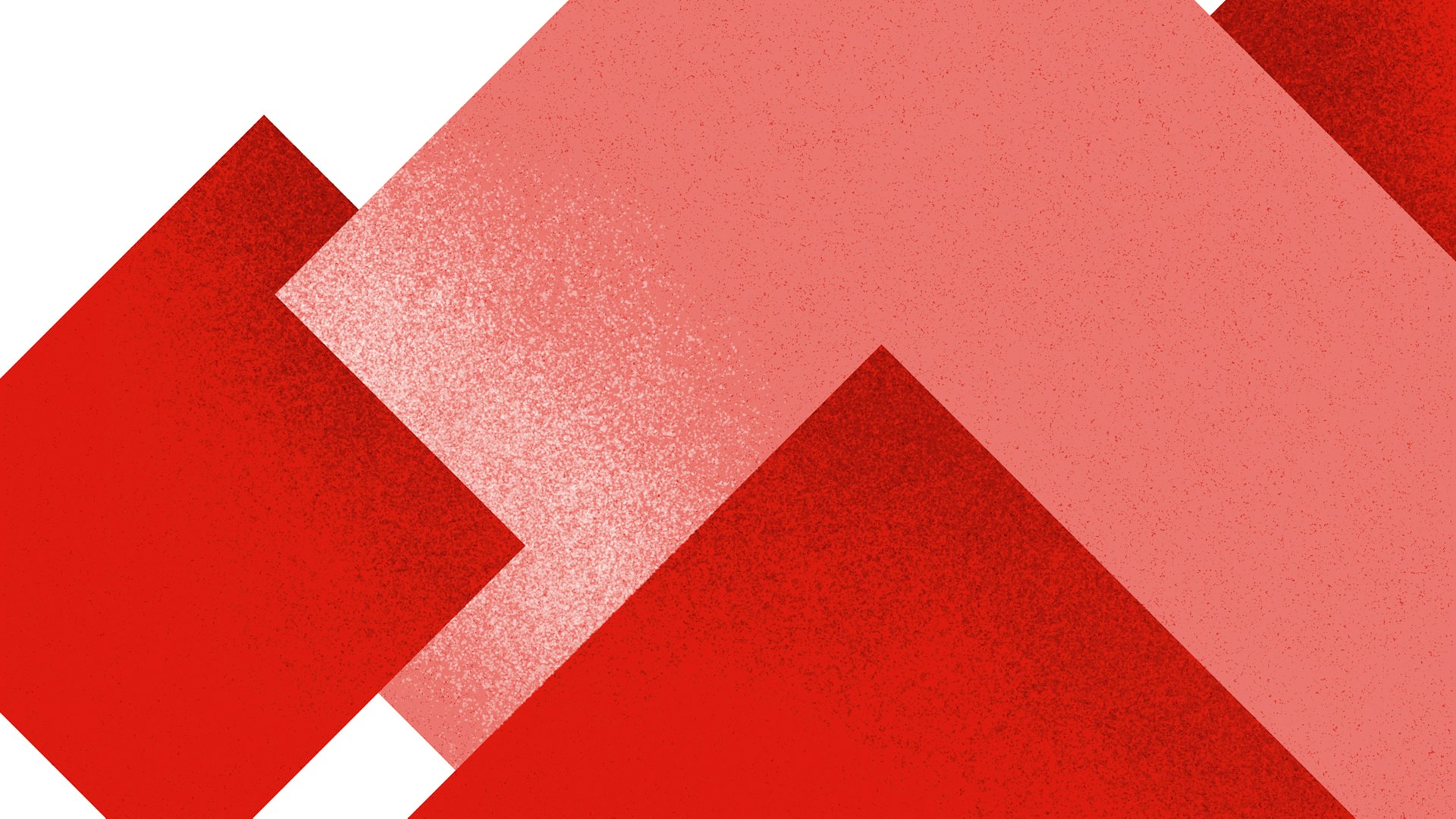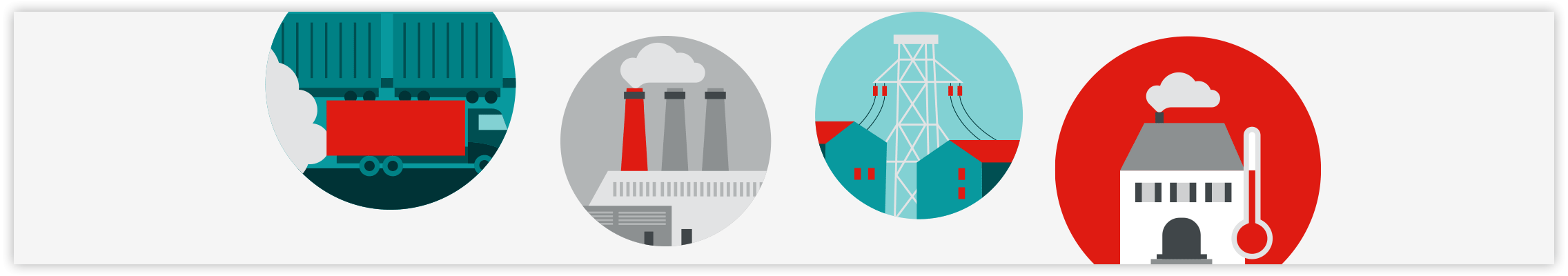magazine_ Interview
„Unsere Haltung dem Staat gegenüber ist die von Konsumenten“
Gespräche zwischen Disziplinen: Der Betriebswirt Josef Bernhart und der Geograf Stefan Schneiderbauer im Interview.
Der Public Management-Experte Josef Bernhart ruft in Erinnerung: Der Staat sind wir alle. Und die Bürokratie, über die wir gerne stöhnen, schafft auch Sicherheit und garantiert gleiche Regeln für die ganze Gesellschaft. Wie lebensgefährlich ein Dasein ohne funktionierende Verwaltung und Kontrollen ist, hat Geograf Stefan Schneiderbauer immer wieder vor Augen, denn er unterstützt Berggebiete in einkommensschwachen Ländern beim Risikomanagement. Die beiden Forscher arbeiten unter denkbar unterschiedlichen Voraussetzungen, aber mit dem gleichen Ziel: nachhaltige Entwicklung.
Herr Bernhart, Ihr Institut hat die Regierungsprogramme der Südtiroler Gemeinden analysiert – gibt es da ein zentrales Thema?
Josef Bernhart: Zentrale Themen für die Südtiroler Gemeindepolitik sind Arbeit und Wirtschaft, soziale Nachhaltigkeit, Mobilität, Umwelt und Raumordnung. Das zeigt, dass die politischen Entscheidungsträger sehr wohl nachhaltigkeitsorientiert denken und handeln. Nachhaltigkeit hat ja mindestens drei Dimensionen, die soziale, die ökonomische und die ökologische. Was dies konkret heißt, haben wir beispielsweise mit der Gemeinde Naturns erarbeitet. Dort entstanden unter breiter Bürgerbeteiligung zunächst ein Nachhaltigkeitsbericht und in der Folge ein strategisches Entwicklungsprogramm, die „Vision Naturns 2030+“. In einem dynamischen Prozess geht es zuerst um die grundsätzliche Frage, was nachhaltige Entwicklung für die Gemeinde in allen drei Dimensionen bedeutet; dann bestimmt man geeignete Indikatoren bzw. Messgrößen dafür. Beispiele sind Wohn- und Betreuungsangebote für Senioren, Beschäftigungsdaten und Energieverbrauch. So wird über die Momentaufnahme hinaus eine Entwicklung sichtbar, man kann systematisch überprüfen, inwieweit man den Nachhaltigkeitszielen näher kommt.
Herr Schneiderbauer, Ihre Arbeit unterstützt die nachhaltige Entwicklung in Berggebieten weltweit, letztens beispielsweise in Burundi: Was ist dort das zentrale Thema?
Stefan Schneiderbauer: Großer Druck auf natürliche Ressourcen – und damit zusammenhängend Ernährungssicherheit. Der ländliche Raum ist extrem dicht besiedelt, und die Felder sind zu klein, um ausreichend Nahrung zu produzieren. Es gibt aber auch keine Alternativen, die Menschen sind absolut abhängig von der Subsistenz-Landwirtschaft. Bei meinem letzten Besuch hat mich beeindruckt, wie anders dort die Corona-Pandemie wahrgenommen wird: Wenn man jeden Tag darum kämpfen muss, satt zu werden, dann relativiert sich die Bedrohung durch das Virus.
Worum ging es in diesem Projekt?
Schneiderbauer: Mit Partnern haben wir analysiert, wie verwundbar Burundi gegenüber Naturrisiken ist, vor allem auch in Zusammenhang mit dem Klimawandel; besonderes Augenmerk lag dabei auf der Risikoanalyse gegenüber multiplen oder sich verstärkenden Gefahren – nehmen wir etwa eine Situation, in der heftige Regenfälle sowohl Überschwemmungen wie Erdrutsche auslösen und die Erdrutsche zusätzlich Verkehrswege blockieren. Die Verwundbarkeit gegenüber solchen Naturgefahren hat verschiedene Dimensionen. Da ist einmal die physikalische: Häuser stürzen schneller ein, wenn sie nicht erdbebensicher gebaut sind, zum Beispiel. Ein weiterer wichtiger Faktor ist die soziale Vulnerabilität: Sie beschreibt unter anderem, inwieweit eine Gesellschaft auf Gefahren vorbereitet ist und damit umgehen kann. Gibt es zum Beispiel einstudierte Notfallpläne oder ein funktionierendes Frühwarnsystem? Unser Team hat diesen Aspekt analysiert, all das, was man zusammenfassend als „institutionelles Setting“ bezeichnet. Davon hängt sehr viel ab. Ohne eine funktionierende öffentliche Verwaltung erhöht sich die Vulnerabilität enorm, denn dann erfolgt im Katastrophenfall keine ausreichende Hilfe. In Burundi zum Beispiel gibt es nur eine sehr schwache öffentliche Struktur des Katastrophenmanagements und das Vertrauen der Bevölkerung ist dementsprechend sehr gering. Im Notfall geht niemand davon aus, dass von offizieller Seite viel Unterstützung kommt. Die Menschen müssen sich also auf andere Netzwerke stützen, zum Beispiel die Familie.
Bernhart: In Südtirol, so mein Eindruck, ist es oft genau umgekehrt. Da heißt es „Das muss der Staat für mich erledigen, das muss die öffentliche Hand machen. Ich zahle ja Steuern.“ Also im Grunde die Haltung von Konsumenten, wie sie auch Richard David Precht in seinem Buch „Von der Pflicht“ beschreibt: „Ich zahle Steuern, und jetzt Staat liefere du mal.“ In den Gebieten, in denen du arbeitest Stefan, kann der Staat nicht liefern. Die Menschen wissen das, sie wissen, dass sie sich selbst helfen müssen. Es gibt einfach sehr wenig institutionelle Ressourcen. Aber vielleicht gibt es dann doch mehr sozialen Zusammenhalt als bei uns, zumindest vor Ort, auch wenn aus der Not geboren? Vielleicht haben wir den ein bisschen verlernt?
Schneiderbauer: Ich kann deine Sicht schon verstehen, und wenn wir mit Risikomanagern hier in Südtirol diskutieren, hören wir auch oft Klagen darüber, dass die Eigenverantwortung zurückgeht und die Leute sich zu sehr auf die öffentliche Hand verlassen. Diese Beobachtung hat natürlich ihre Berechtigung, aber ich halte das trotzdem für Nörgeln auf hohem Niveau. Denn das große Vertrauen in die öffentliche Hand beruht ja auf den vielen positiven Erfahrungen, die die Menschen bei früheren Naturereignissen gemacht haben. Wenn es darauf ankommt, kann man sich in Südtirol einfach darauf verlassen, dass Abläufe und technisches Gerät funktionieren und dass die Beteiligten alles tun, um Schaden abzuwenden. Und der Gemeinschaftsgedanke ist in Südtirol ja gerade in den Tälern und Dörfern noch ganz stark. In den Ländern und Regionen, in denen wir arbeiten, ist das oft ganz anders, etwa aufgrund großer Migrationsbewegungen; da gibt es oft keine stabile, funktionierende lokale Gemeinschaft mehr. Und selbst wenn geeignete Gesetze existieren, etwa Vorschriften für erdbebensicheres Bauen, haben sie oft keinerlei Wirkung, weil niemand ihre Einhaltung kontrolliert. Das ist wieder ein Beispiel dafür, wie die Schwäche des institutionellen Settings das Risiko erhöht.
Bernhart: Bei uns, wo die Kontrollen penibel durchgeführt werden, stöhnen die Leute dann über die Bürokratie. Es ist ganz aus dem Blick geraten, dass Bürokratie auch Sicherheit garantiert, einen Standard an Vergleichbarkeit, gesicherte Verfahrensabläufe. Umgangssprachlich ist Bürokratie als Begriff negativ besetzt, und generell war die Haltung vor der Corona-Pandemie: Staat, bleib mir möglichst vom Hals. Weniger Staat! Das wollten viele. In der Pandemie aber wurde dann plötzlich von allen Seiten nach dem Staat gerufen, nach Corona-Hilfen, da war der Staat der Heilsbringer. Also wäre der Staat eine Person, sie könnte mit Recht sagen: Vorher wolltest du mich zurückdrängen, jetzt soll ich dich plötzlich retten. Der Staat aber sind wir alle, am Ende müssen wir alle das Geld erwirtschaften, das der Staat ausgibt. Die Corona-Pandemie ist aber auch ein gutes Beispiel, wie übertriebene Bürokratie im Verwaltungskontakt vermieden werden kann, indem man den Bürgerinnen und Bürgern mehr Eigenverantwortung überträgt: Ich nenne da als Beispiel immer die Ersatzerklärung oder autocertificazione. Offizielle Fakten selbst zu bescheinigen, ohne dafür eigens das Amt aufsuchen zu müssen. Da war Italien insbesondere seit den 1990er Jahren Vorreiter.
Ist das Image der italienischen Verwaltung also zu Unrecht schlecht?
Bernhart: Jene Medien, die nach dem Prinzip bad news is good news funktionieren, zeichnen ein verzerrtes Bild, wenn sie pauschal negativ berichten und sich nur auf Einzelfälle konzentrieren. Denn Umfragen zeigen immer wieder, dass die Menschen mit der öffentlichen Verwaltung insgesamt zufrieden sind, auch wenn es für Italien im europäischen Vergleich Luft nach oben gibt. Bemerkenswert ist auch, dass Italiens Verwaltungen seit Jahren dazu verpflichtet werden, die unmittelbare Zufriedenheit der Bürgerinnen und Bürger zu erfassen – sowohl, wenn sie ein Amt persönlich aufsuchen, als auch, wenn sie es telefonisch oder online kontaktieren. Hier zeigt sich eine hohe Zufriedenheit, vor allem mit der Abwicklung direkt im Amt; unzufrieden sind die Menschen, wenn sie zu lange warten mussten. Es gibt in Italien viele Managementreformen und innovative Maßnahmen, etwa die Einführung der digitalen Identität. Bei den verfügbaren Online- Diensten vor allem für Unternehmen steht Italiens öffentliche Verwaltung auch international gut da.
"Es ist ein Fehler, zu denken, Digitalisierung bedeute immer Vereinfachung."
Josef Bernhart
Kommen die Menschen da aber auch mit? In einigen Ländern Europas wehren sich ältere Bürgerinnen und Bürger, weil sie sich durch die zunehmende Digitalisierung von Dienstleistungen ausgeschlossen fühlen.
Bernhart: Die öffentliche Verwaltung gehört in Italien tatsächlich zu den Bereichen, wo die Digitalisierungsbereitschaft im europäischen Vergleich relativ gering ist – ein großer Teil der Menschen bevorzugt immer noch den direkten Kontakt. Natürlich ist das auch eine Generationenfrage. Meine Mutter, über 80, unterschreibt lieber ein gedrucktes Formular, als etwas online zu erledigen. Es ist auch ein Fehler, zu denken, Digitalisierung bedeute immer Vereinfachung. Weder wird alles automatisch einfacher, noch wird es gleich günstiger, denn zunächst müssen die Strukturen ja aufgebaut werden. Digitalisierung braucht Technologien, und die kosten Geld. Außerdem muss die Möglichkeit des analogen Zugangs zumindest für bestimmte Zielgruppen und eine gewisse Zeit trotzdem garantiert werden, um niemanden auszuschließen oder zu benachteiligen. Die öffentliche Verwaltung fußt ja auf dem Grundsatz der Gleichbehandlung.
"Einkommensschwache Länder können durch digitale Technologie kostenaufwendige Infrastrukturentwicklung überspringen – der Aufbau eines Telefon-Festnetzes etwa wird durch Smartphones überflüssig."
Stefan Schneiderbauer
Herr Schneiderbauer, welche Rolle spielt Digitalisierung für die Entwicklung der abgelegenen Regionen, in denen sie arbeiten?
Schneiderbauer: Digitale Informations- und Kommunikationsprozesse sind von enormer Bedeutung, gerade auch in jenen Bereichen, in denen wir hauptsächlich arbeiten, also Katastrophenschutz, Klimarisiken, Klimaanpassung. Frühwarnsysteme etwa sind essenziell, um die verheerendsten Folgen von Naturereignissen zu vermeiden. Rechtzeitige Information über drohende Wetterlagen kann Ernteausfälle verhindern. Den Zugang zu modernen Technologien zu ermöglichen und auszubauen ist deshalb ein wichtiger Aspekt bei der Zusammenarbeit mit diesen Ländern. Durch digitale Technologie kann man auch kostenaufwendige Infrastrukturentwicklung überspringen, etwa den Aufbau eines Telefon-Festnetzes, der durch Smartphones überflüssig wird.
Tun die Industrienationen als Verursacher des Klimawandels genug, um den einkommensschwachen Ländern zu helfen, die wenig zur Erderwärmung beigetragen haben, aber unter den Folgen besonders leiden? Die Höhe dieser finanziellen Hilfe war bei den letzten Weltklimakonferenzen heftig umstritten
Schneiderbauer: Das ist vollkommen richtig, wie viel Geld von den klimawandelverursachenden Industrienationen in die Länder des Globalen Süden fließen sollen und müssen, um die heftigsten Auswirkungen der globalen Erwärmung abschwächen zu können, wird heftig diskutiert. Im Pariser Klimaabkommens haben sich die Industriestaaten dazu verpflichtet, ab dem Jahr 2020 jährlich 100 Mrd. USD bereitzustellen. Das hört sich erstmal nach einer nicht unerheblichen Summe an. Allerdings stellt man bei genauem Hinschauen fest, dass ein großer Teil dieser Gelder nur als Kredite gewährt werden und vor allem, dass es viel zu lange braucht, bis diese Gelder den betroffenen Gebieten wirklich zur Verfügung stehen um z.B. Anpassungsprojekte konkret durchzuführen.
Sehen Sie in den Erfahrungen des jeweils anderen auch Anregungen für ihre eigene Arbeit?
Schneiderbauer: Schon allein aus diesem Gespräch habe ich den Eindruck, dass es da interessante Berührungspunkte gibt. Die systematische Beobachtung und Evaluation von Nachhaltigkeitsindikatoren für alle drei Komponenten etwa, die Josef beschrieben hat: Da könnten wir sicher einiges abgucken.
Bernhart: Was Stefan berichtet hat, bestätigt mir wieder eindrücklich, dass Nachhaltigkeit nur global gelingen kann, weil wir letztlich alle Teil einer Welt sind. Man muss lokal handeln – aber immer global denken. Das kommt in Stefans Projekten für mich sehr deutlich zum Ausdruck.
Josef Bernhart
Josef Bernhart, Betriebswirt, hat an der Universität Innsbruck zum Qualitätsmanagement in öffentlichen Verwaltungen promoviert und ist seit 2001 stellvertretender Leiter des Instituts für Public Management. Seine Leidenschaft gilt beruflich der Entbürokratisierung, ehrenamtlich der christlich-sozialen Bewegung und in der Freizeit dem Radsport. In allen Bereichen ist Durchhaltevermögen gefragt.
Stefan Schneiderbauer
Stefan Schneiderbauer ist Geograf und befasst sich seit mehr als 20 Jahren mit (Klima-) Risikomanagement in Berggebieten. Bei Eurac Research leitet er für die Universität der UNO das Programm GLOMOS, das die Erhaltung und nachhaltige Entwicklung von Berggebieten weltweit unterstützt. Er ist gerne in der Natur, liebt die Berge und das Baden in eiskalten Seen.